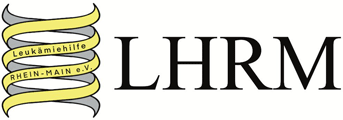Von anonym
Von anonym
Vor etwa elf Jahren war ich in der gleichen Situation wie einige von ihnen, ich litt an einem Myelodysplastischen Syndrom (MDS).
Das was auf sie vll. zukommt, habe ich inzwischen hinter mir und ich fühle mich nach einer vor fast acht Jahren erfolgten Stammzellentransplantation, inzwischen ganz ohne Medikamente, gesund und munter.
Ich möchte als Betroffener versuchen, ihnen einen Einblick in meine Krankengeschichte zu geben, die Geschichte einer Krankheit, die man zwar vielleicht vom Hörensagen kennt und evtl. mit dem Sänger José Carreras in Verbindung bringt, aber selbst nicht wirklich kennt. Weil man bisher nicht betroffen ist, ignoriert man diese Erkrankung, die einen großes Unbehagen vermittelt, aber überwunden werden kann!
Möglicherweise ergeben sich bei meinen Darlegungen einige Parallelen zu ihnen, aber sie sollten sie nicht überbewerten, sondern ihren eigenen Umgang mit der Krankheit finden. Furcht davor, ist ein schlechter Ratgeber!
Auch ich hatte mich vor meiner Erkrankung mit dem Thema Leukämie kaum befasst.
Umso überraschter war ich deshalb nach einem obligatorischen Gesundheitsscheck im Oktober 2003 über die Nachricht meines Hausarztes, dass er mich wegen schlechter Blutwerte unbedingt an einen Hämatologen überweisen müsse.
Der erste Besuch bei diesem ergab die ernüchternde Feststellung, dass ich an MDS leide. Ich hatte noch nie von einer derartigen Krankheit gehört.
Eine von mir im Internet entdeckte Dokumentation dazu eröffnete für mich wegen einiger beängstigender Andeutungen keine gute Perspektive. Kaum zu glauben, denn ich merkte nichts und fühlte mich zu diesem Zeitpunkt körperlich absolut fit. Einige Zeit später zeigten sich allerdings erste Anzeichen. Beim Radfahren musste ich an leichten Steigungen absteigen, beim Treppensteigen kam ich außer Atem und verspürte nach 12 Stufen ein Brennen in den Oberschenkeln.
Das also waren die Vorboten dieser, sich meiner bemächtigenden Krankheit!
Da ich von Grund auf ein optimistischer Mensch bin, beschloss ich, trotz der erschreckenden Nachricht, mich nicht davon überwältigen zu lassen, sondern die Zeit sinnvoll zu nutzen und alle negativen Gedanken zu verdrängen.
Ohne besondere Auflagen im Hinblick auf Ernährung oder bisherige Lebensgewohnheiten, verhielt ich mich weiter wie bisher mit allem, was zu einem „normalen” Leben mit Familie und Freundeskreis dazu gehört. Mit gleichem Elan wie bisher bewältigte ich außerdem die anstehenden bzw. begonnenen Bau- und Sanierungsarbeiten in unserem Haus und Grundstück.
Trotzdem aber änderte sich etwas in meinem Leben!
Ich wurde abhängig von den ständigen Arztbesuchen und den ab Frühjahr 2004 erforderlichen Blutkonserven, da sich meine Hämoglobin-Werte kontinuierlich verschlechterten, (z.B. 3,7 mmol/l).
Für die Transfusionen waren in Zittau immer zwei Tage erforderlich. Deshalb und im Hinblick auf eine mögliche wissenschaftliche Begleitung überwies mich mein Hausarzt im Mai 2004 an die Uni-Klinik Dresden. In der „Hämatologischen Ambulanz“ erhielt ich die Blutübertragungen innerhalb von vier bis fünf Stunden. Mein Krankheitsverlauf wurde auch durch Untersuchungen in anderen Fachabteilungen laufend überwacht, so dass jederzeit auf evtl. Nebenerscheinungen bzw. Veränderungen reagiert werden konnte. Außerdem war ich in mehrere Studien eingebunden. Ich konnte mich hier also rundum gut aufgehoben fühlen!
Zu dieser Zeit ging es mir noch relativ gut, musste aber doch bald eine permanente körperliche Verschlechterung konstatieren.
In Anbetracht dieser Tatsache und das sich in kürzer werdenden Zeiträumen die Anzahl der Blutkonserven erhöhte, wurde ich schonend auf eine notwendige, “Blutstammzellen- Transplantation“ vorbereitet. Parallel dazu wurde nach in Frage kommenden Fremd-Spendern gesucht. Außerdem prüfte man die Blutwerte meines Bruders auf evtl. Übereinstimmung, befand sie aber für nicht passend.
Da ich den Ausgang der Transplantation nicht einschätzen konnte, bewältigte ich 2006 vorsorglich noch einige, notwendige Baumaßnahmen in Haus und Grundstück. Ich wollte sie unbedingt vorher erledigt wissen.
Zum Jahresende zeigten sich immer häufiger werdende Infekte mit leichtem Fieber und vielen Unpässlichkeiten. Dieser Zustand hielt sich bis Anfang Februar 2007 in über-schaubaren Grenzen, bis zu einer Einweisung ins Klinikum Ebersbach, mit Verdacht auf Herzinfarkt. Ursache für die Schmerzen in Brust und linkem Arm waren allerdings starke Schwellungen von Milz und Leber, damit verbunden die Reizung der Zwischenrippennerven und außerdem eine bakterielle Gallenblasenentzündung. Einigermaßen genesen wurde ich entlassen. In der Uni- Klinik erfolgte danach die kontinuierliche Weiterbehandlung. Diverse Laboruntersuchungen ergaben dabei, dass sich mein Allgemeinzustand enorm verschlechtert hatte.
Das bewog die Ärzte, mir das damals noch nicht zugelassene, aber in den USA mit Erfolg eingesetzte Medikament “Revlimid“ zu verabreichen. Es bewirkte zwar eine momentane Stagnation, wurde aber nach etwa vierzehn Tagesdosen wieder abgesetzt, Der erhoffte Erfolg war bei mir nicht eingetreten.
Im Hinblick auf die geplante Stammzellentransplantation, bat ich noch einmal um ein informelles Gespräch mit meinem behandelten Professor. Er machte mir unverblümt klar, dass ich, ohne eine Stammzellentransplantation, noch eine Lebenserwartung von ca. 1½ bis 2 Jahren hätte und das bei immer schlechter werdender Lebensqualität!
Trotz einer, zu diesem Zeitpunkt bekannten Erfolgsquote von etwa 50 - 60 %, entschloss ich mich für die Transplantation.
Jede andere Entscheidung wäre eine gegen meine Natur gewesen!
Ich stellte mich mental auf diese Behandlung ein, zumal es mir peu à peu immer schlechter ging und der Transplantationstermin mit dem 5. April 2007 definitiv feststand.
Ab Mitte März hatte ich mit ständigem Fieber, verbunden mit Schüttelfrost und allerlei anderen Ungereimtheiten, wie entzündete Augen, Appetitlosigkeit, Mattigkeit und andauernden Leibschmerzen, d.h. einer generellen Verschlechterung zu tun. Die im permanenten Ansteigen befindlichen Blasten (von 5% im Januar, auf ca 14 % im März) und die trotz ständiger Blutkonserven niedrigen HB-Werte, waren die klaren Anzeichen dafür. dass sich die Leukämie endgültig durchgesetzt hatte,
Da mir die zu Hause verabreichten Medikamente keine Besserung brachten, wurde ich am 22. März in die Intensivstation eingewiesen, um die Infektion stationär behandeln zu können. Damit verbunden, erfolgte durch Ärzte und Schwestern die Vorbereitung auf die bevorstehende Transplantation. Mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen vermittelten sie mir Vertrauen und Zuversicht, so dss ich diesem bevorstehenden Prozedere beruhigt entgegensehen konnte.
Allerdings denke ich, wäre es falsch, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass es sich bei dieser komplizierten Therapie um eine Sache handelt, die so nebenbei abläuft, die man einfach abhaken kann……dem ist nicht so!
Ganz bewusst möchte ich ihnen einige Dinge erzählen, die mir in Erinnerung geblieben sind und mir immer wieder vor Augen führen, wie dankbar ich für jeden Tag meines Lebens nach all den Belastungen der Transplantation sein kann!
Günter Mory
(Fortsetzung in ca. 1 Woche wieder hier)